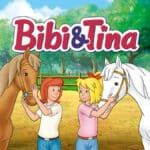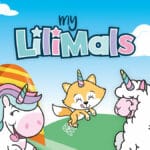Kinderrechte – und was sie mit Spielkarten zu tun haben

Dort! Zwischen Laternenumzügen, Adventskalender-Planung und Geschenke-Listen finden wir ihn. Einen Tag, der leicht untergeht und übersehen wird, wenn es hektisch wird – ein bisschen so, wie die, um die sich der Tag dreht. Am 20. November ist Tag der Kinderrechte. Moment, Kinderrechte? Klingt irgendwie nach trockenen Verträgen – nach etwas, das in Gremien und Räten besprochen wird. Theoretisch. Aber eigentlich betreffen sie ganz alltägliche Situationen: Wer wird ernst genommen? Wer darf mitreden? Wer wird geschützt? Und wie? Ganz praktisch. Schauen wir uns die wichtigsten Fragen rund um das Thema Kinderrechte einmal an.
Warum gibt es Kinderrechte?
Kurz gesagt: Damit Kinder nicht ausgeliefert sind, sondern überall auf der Welt faire Chancen auf ein gutes, selbstbestimmtes Leben haben. Dass Kinder eigene Bedürfnisse haben, wurde und wird häufig übersehen oder nicht wichtig genommen. Genau deshalb wurde 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet – eine Art weltweiter Vertrag, der festlegt, welche Rechte jedes Kind hat, ganz egal, wo es lebt. Kinderrechte sollen sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Kindern nicht vom Zufall abhängen, sondern verlässlich geschützt sind: das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Fürsorge, nach Bildung, nach einer eigenen Stimme und nach einer Umgebung, in der sie gesund aufwachsen können. Wenn man so will, sind Kinderrechte das Regelwerk, das sicherstellen soll, dass Kinder die faire Chance auf ein gutes Leben bekommen – so wie ein Spiel erst dann Spaß macht, wenn niemand schummelt, wenn alle die Regeln kennen und wenn jede Stimme am Tisch zählt.
Welche Kinderrechte gibt es?
Die UN-Kinderrechtskonvention ist ziemlich umfangreich – es gibt 54 Artikel. Das klingt erst mal nach einer sehr dicken Spielanleitung. Für den Alltag lassen sich diese Kinderrechte aber grob in ein paar große Bereiche einteilen, die man sich gut merken kann.

Recht auf Schutz
Kinder haben das Recht, vor Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung geschützt zu werden. Sie dürfen nicht geschlagen, gedemütigt oder bedroht werden – weder körperlich noch seelisch. Sie sollen nicht zur Arbeit gezwungen werden. Besonders Kinder, die auf der Flucht sind oder in Kriegsgebieten leben, brauchen zusätzlichen Schutz.
Recht auf Förderung und Entwicklung
Kinder haben ein Recht darauf, dass sie gesund aufwachsen und sich gut entfalten können. Das bedeutet, dass sie medizinische Versorgung bekommen, genug zu essen haben, in einer sicheren Umgebung leben und Zugang zu Bildung haben.
Und hier kommt ein Punkt, der uns besonders freut: Spielen ist ein Kinderrecht. Kinder haben ein Recht auf Freizeit, Erholung und Spiel – das ist kein Bonus, den man gewährt, wenn alles andere erledigt ist, sondern ein wichtiger Baustein ihrer Entwicklung. Im Spiel lernen Kinder, Regeln zu verstehen, fair zu bleiben, mit Frust umzugehen, zu gewinnen, zu verlieren und kreative Lösungen zu finden. Jede Runde Karten ist damit nicht nur Zeitvertreib, sondern ein kleines Training für das echte Leben.
Recht auf Beteiligung
Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu sagen – in allen Angelegenheiten, die sie betreffen – und sie haben das Recht, ernst genommen zu werden. Das heißt nicht, dass Kinder ab sofort den Wochenplan diktieren oder alleine entscheiden, wann Schlafenszeit ist. Es heißt aber, dass ihre Sicht auf die Dinge Gewicht hat. In der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft: Überall dort, wo ihr Alltag gestaltet wird, sollen Kindern mitreden. Wer Kindern am Spieltisch zuhört, erkennt das sofort: Da werden Regeln diskutiert, neue Varianten vorgeschlagen und mit viel Leidenschaft verhandelt – „Nur noch eine Runde!“
Recht auf Gleichheit und Nicht-Diskriminierung
Alle Kinder haben die gleichen Rechte – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache, Geschlecht, einer möglichen Behinderung oder der finanziellen Situation der Familie. Kein Kind darf ausgegrenzt oder schlechter behandelt werden. Punkt.

Was können wir als Erwachsene tun?
Außer gleich in die Politik zu gehen, können wir viel für Kinderrechte tun – oft mit kleinen Gesten im Alltag. Zuhören ist ein guter Anfang: Wenn ein Kind erzählt, verdient es volle Aufmerksamkeit. Ebenso wichtig ist Erklären, damit Kinder verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden. Indem wir ihre Meinung ernst nehmen und Fragen wie „Wie siehst du das?“ stellen, stärken wir ihr Recht auf Beteiligung. Respekt zeigen wir auch, wenn wir Grenzen akzeptieren – etwa bei Nähe oder dem hundertsten Foto. „Jetzt lächel doch mal!“. Und wir schaffen Freiräume fürs Spiel, statt alles durchzutakten. So werden Kinderrechte nicht nur besprochen, sondern gelebt.
Gleiche Regeln vs. gleiche Chancen
Genauso wichtig ist in diesem Zusammenhang die Frage nach echter Chancengleichheit. Denn oft wirkt es auf den ersten Blick gerecht, wenn für alle die gleichen Regeln gelten. Doch echte Gerechtigkeit entsteht erst dann, wenn alle dieselben Möglichkeiten haben, mitzuhalten. Ein Kind, das jünger ist oder ein Spiel noch nicht gut kennt, startet eben nicht mit denselben Voraussetzungen wie erfahrene Spieler:innen. Manchmal braucht es deshalb kleine Anpassungen – ein paar Extrahilfen, ein langsameres Tempo oder eine zusätzliche Erklärung. Das ist kein „Bevorzugen“, sondern ein Ausgleich, der ermöglicht, dass alle wirklich mitspielen können. Und das gilt eben nicht nur am Spieltisch, sondern auch im Alltag. Gerechtigkeit heißt nicht Gleichmacherei, sondern faire Chancen für alle.
Kinderrechte für alle
Nur, weil es Kinderrechte gibt, bedeutet es leider nicht, dass sie auch umgesetzt werden. Noch immer gibt es Orte überall auf der Welt – auch hier –, wo Kinder zu kurz kommen und die Rechte für sie nicht zu gelten scheinen. Gut, dass es zumindest den Tag der Kinderrechte gibt. Der 20. November erinnert uns und lässt uns den Fokus neu setzen. Hier bei ASS Altenburger beschäftigen wir uns jeden Tag mit den Momenten, in denen Familien, Freunde – oder auch Wildfremde – gemeinsam den Alltag hinter sich lassen und sich Spielfreude entfalten kann. Am Spieltisch sind alle gleich. Und genau dort, am Spieltisch, wird oft besonders deutlich, wie wichtig Kinderrechte sind: Wenn alle drankommen, wenn die Regeln für alle gelten, wenn niemand ausgegrenzt wird, dann fühlt sich das ein bisschen an wie eine Mini-Version einer gerechten Welt, oder?